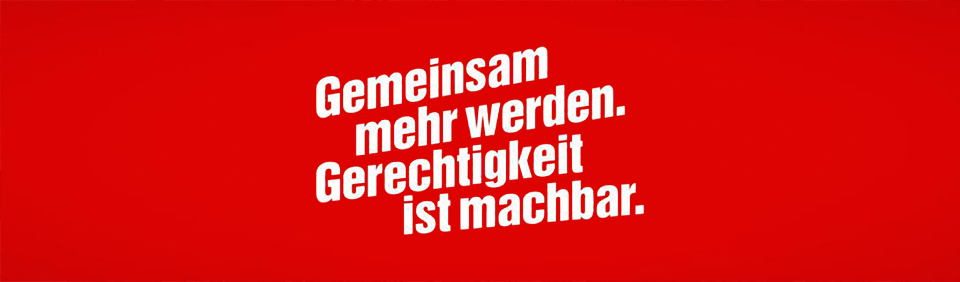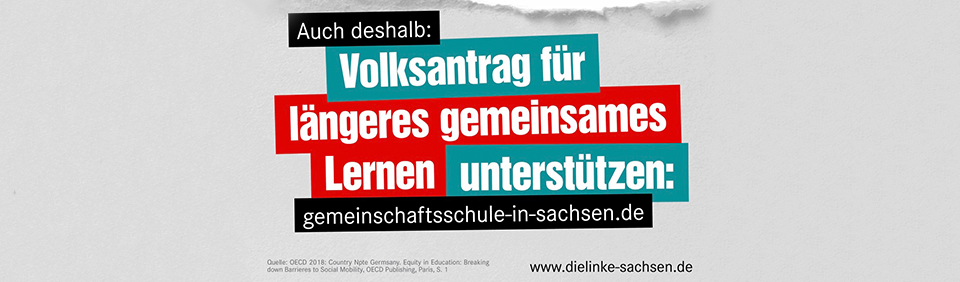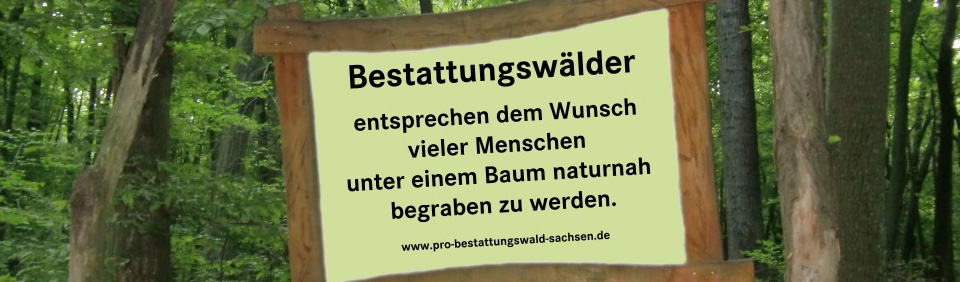Marion Junge über KZ-Außenlager Kamenz: „Das darf nie wieder passieren.“
Erstellt am: 7 März, 2025 | Kommentieren

Die Leichen von mindestens 30 überwiegend sehr jungen Häftlingen wurden hier verbrannt. Dafür war das stillgelegte Kesselhaus damals extra wieder hergerichtet worden. In der Asche fanden sich menschliche Knochen. Von den etwa 1.000 Häftlingen sind nachweislich 182 im KZ-Außenlager Kamenz-Herrental zwischen 1944 und 1945 ermordet worden oder an den Folgen von Mangelernährung, Entkräftung und Krankheiten gestorben – das darf niemals vergessen werden, sagt Marion Junge. Zum Gedenktag am 10. März werden deswegen neue Namenspaten für die Opfer gesucht.
Die Kamenzerin Marion Junge steht an der Gedenkstätte KZ-Außenlager Kamenz-Herrental. Sie hält eine Urkunde über eine Namenspatenschaft in der Hand. Drei Patenschaften hat sie insgesamt abgeschlossen. Zu den drei jungen Männern, die hier qualvoll ums Leben kamen, existieren kaum mehr als ihre Namen.
Ein Italiener, Carlos Caris, geboren 1912, wurde hier gefangen gehalten – irgendwann zwischen November 1944 und dem Tag der Auflösung und Evakuierung des Lagers am 10. März 1945. Viele, der ca. 1.000 Häftlinge, die zur Nazi-Zeit hier eingesperrt waren, und in den für die Rüstungsproduktion umgestellten Betrieben in Kamenz schuften mussten, bleiben ohne Identität. Von 182 Menschen weiß man, dass sie hier starben. Weitere kamen sicherlich auch nach dem 10. März 1945 noch ums Leben. Es ist eine düstere, traurige Vergangenheit, die sich niemals wiederholen darf, sagt Marion Junge. Deshalb werden jetzt neue Namenspaten gesucht – um dem Vergessen entgegenzuwirken, den Toten wieder ihre Namen zurückgeben.
Marion Junges Opa war als Soldat in sowjetischer Kriegsgefangenschaft.
„Ich kam bereits als Kind mit dem Thema Krieg in Kontakt, denn mein Opa war in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Ich habe mich viel mit meiner Oma dazu ausgetauscht“, erinnert sich die Kamenzerin, die seit vielen Jahren auch im Stadtrat sitzt. „Ich bin damit groß geworden und habe mich schon als Jugendliche für Frieden engagiert, und auch der Ost-West-Konflikt spielte dabei eine Rolle.“ Die Gedenkstätte KZ-Außenlager Kamenz-Herrental sei eine „geschichtliche Mahnung“. Wir sehen hier was passieren kann, wenn wir wieder in den Fokus des Krieges kommen. Das darf nie wieder passieren“, mahnt die Namenspatin.
Sie hat ihre Namenspatenschaften für die Opfer aus der Nazi-Zeit in Kamenz bereits 2010 abgeschlossen. Seit 2005 hat Marion Junge als Stadträtin die Initiative zur Bewahrung des Gedenkens an die Opfer faschistischer Gewaltherrschaft in Kamenz unterstützt, aus der sich dann der Förderverein für eine Gedenkstätte entwickelte. „Als wir damals hörten, dass das Gelände renaturiert werden soll, wuchs die Hoffnung und Idee eine Gedenkstätte an diesem geschichtsträchtigen Ort zu gestalten. Ich kümmerte mich u.a. um Spenden und Unterstützer zu finden, um eine Gedenkstätte im Herrental zu errichten, in welche die Gedenktafel aus dem Jahre 1952 integriert wurde“, sagt Junge.
„Die Häftlinge müssten bis zur Erschöpfung arbeiten“
Andreas Koch, der Vorsitzende des Fördervereins Gedenkstätte KZ-Außenlager Kamenz-Herrental e.V. erzählt, dass Knochenfunde im alten Heizhaus zeigten, dass mindestens 30 Menschen dort verbrannt wurden. „Es war ein Lager, wo die Arbeitskräfte schliefen. Von dort aus mussten sie ins damalige Glaswerk zum Arbeiten etwa 2,5 km marschieren. Dort wurden Teile für Flugzeugmotoren von Daimler Benz hergestellt. Die Häftlinge müssten bis zur Erschöpfung arbeiten“. Das hätten die Recherchen ergeben. Die SS habe die Häftlinge an Konzerne verliehen. „Als die Front vorrückte, war das KZ-Außenlager hier in Kamenz entstanden“, sagt Andreas Koch. Derartige Lager habe es unter anderem auch in Bautzen, Ruhland, Radeberg und vielen anderen Orten gegeben.
An der Gedenkstätte erinnern Tafeln an Verstorbene. 182 Namen sind dort zu lesen. Dass sie hier ihr Leben verloren, sei anhand von 54 Totenscheinen und dem Vergleich von Transportlisten nachweisbar. Nur über einen der toten Häftlinge weiß der Verein etwas mehr. „Es ist schwer etwas herauszufinden“, sagt Marion Junge: „Der Sohn eines Opfers, Michael Caron, wusste, dass sein Vater, der den gleichen Namen trug, hier in Kamenz starb. Er hat die Lebensetappen seines Papas in unterschiedlichen Gefängnissen aufgeschrieben. Das Buch ‚Eine Reise an das Ende einer Nacht‘ war limitiert erschienen, und ist kaum noch zu erwerben, aber in der Bibliothek von Kamenz vorhanden.“
Teils wurden die Männer nur 19 Jahre alt
Die in Archiven zugänglichen Personaldaten von 861 Häftlingen lassen Rückschlüsse auf ihre Nationalität zu. Darunter waren 230 Russen, Ukrainer u.a. Sowjetbürger, 205 Franzosen, 119 Italiener, 105 Polen, 67 polnische und ungarische Juden, 40 Belgier, 31 Deutsche und 29 Tschechen. Fast ein Drittel waren sehr junge Häftlinge der Jahrgänge 1921-1925, d.h. sie waren damals gerade 19-25 Jahre alt. 50 % aller Häftlinge waren nicht älter als 30 Jahre, typisch für Außenlager, die bei den Rüstungsbetrieben geschaffen wurden.
Am 10. März 2025 wird es auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers ab 16 Uhr eine Gedenkveranstaltung geben. Grund ist vor allem der 80. Jahrestag der Auflösung des Lagers. Es soll eine Mahnung sein für eine friedliche Welt.
Neue Paten gegen das Vergessen werden noch gesucht
Rund 50 neue Namenspatenschaften seien derzeit zu vergeben. „Das bedeutet, dass die neuen Paten dem Förderverein 50 Euro spenden.“, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Koch: „Darüber hinaus können sie z. B. Blumen niederlegen und erhalten Informationen zu Gedenkveranstaltungen. Als Namenspate erhalten sie eine Urkunde, mit dem Namen und den Geburts- und Sterbedaten des ums Leben gekommenen KZ-Häftlings“, erklärt er.
Das Geld soll dafür genutzt werden, um über die Internetseite „Gedenkplaetze.info“ vermisste Menschen aus der Nazi-Zeit online auch in Kamenz finden zu können. „Dafür wollen wir eine technische Lösung finden“, erklärt Koch.
Marion Junge schaut auf ihre Urkunde mit den drei Namen, zwei erinnern an Kriegsgefangene aus Italien, eine an einen jungen Mann aus Frankreich. Sie legt Blumen nieder. „Das darf nie wieder passieren“, appelliert sie an die heutige Zeit.
Verfasser/innen: Siri Rokosch (SZ), Andreas Koch und Marion Junge (Förderverein)
Schlagwörter: Förderverein KZ-Außenlager Kamenz-Herrental e.V. > Gedenkveranstaltung
Kommentare
Schreibe eine Antwort